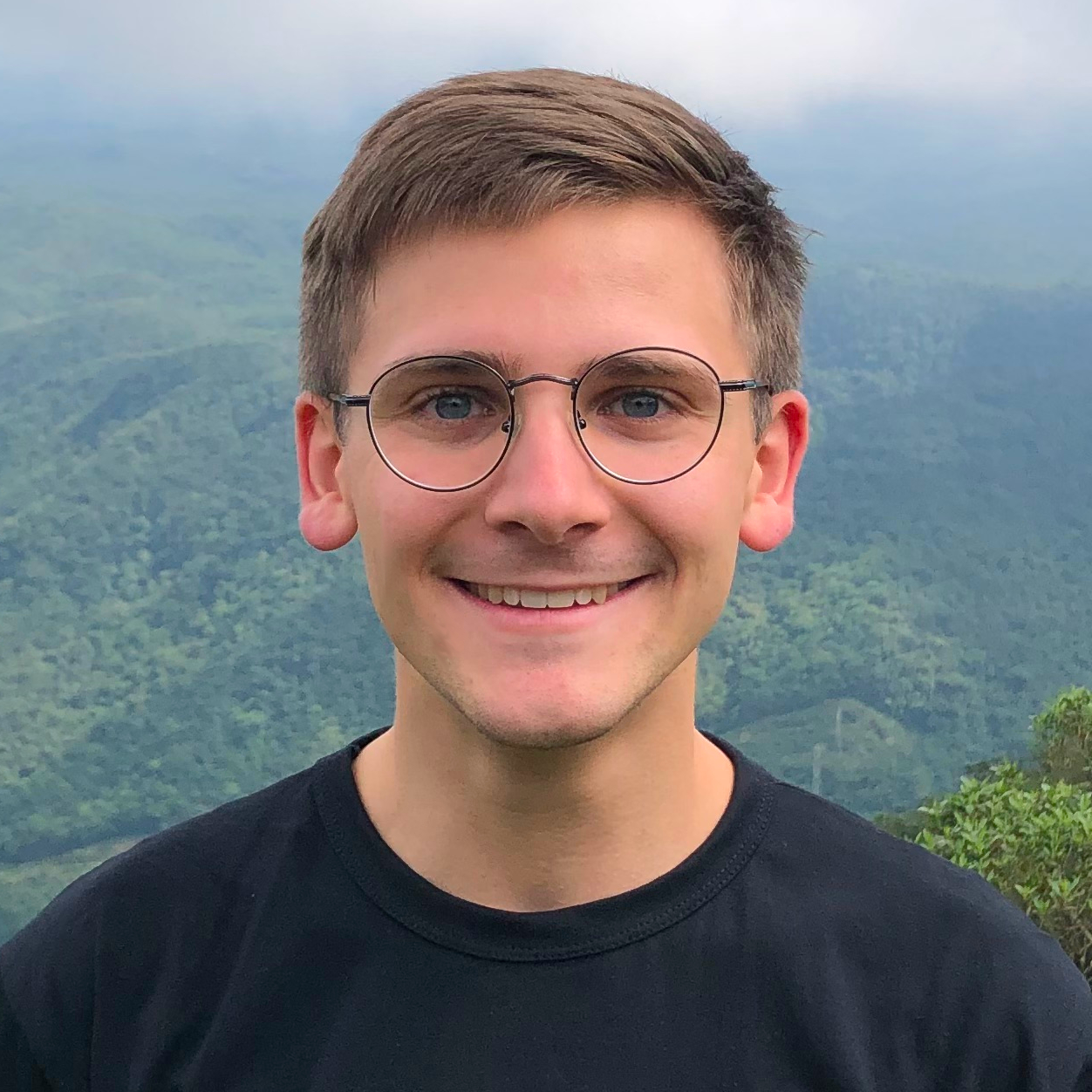Die Gretchenfrage, das Cusanuswerk und die Studienstiftung
Disclaimer
In meiner Studienzeit wurde ich durch das Cusanuswerk, das Begabten-Förderungswerk der katholischen Kirche, sowie durch die Studienstiftung des deutschen Volkes finanziell wie ideell unterstützt. Das Cusanuswerk möchte nicht, dass sich einzelne Stipendiat*innen stellvertretend in seinem Namen äußern. In den sog. Hinweisen für Stipendiatinnen und Stipendiaten heißt es:
Jeder ist für seine Äußerungen grundsätzlich persönlich verantwortlich. Stipendiatinnen und Stipendiaten des Cusanuswerks können Meinungsäußerungen ausschließlich im eigenen Namen veröffentlichen und dürfen sich dabei nicht auf die Zugehörigkeit zur Bischöflichen Studienförderung Cusanuswerk beziehen. Dies gilt für schriftliche Stellungnahmen wie für Meinungsäußerungen gegenüber Medien und in anderen öffentlichen Zusammenhängen. Stipendiatinnen und Stipendiaten dürfen weder individuell noch als Gruppe als Repräsentanten des Cusanuswerks in Erscheinung treten. Offizielle Statements geben nur die dafür von der Leitung des Cusanuswerks autorisierten Personen ab.
Hiermit sei also darauf hingewiesen, dass ich mit dem Ende meiner Studienzeit inzwischen aus der Förderung des Cusanuswerks ausgeschieden bin und sämtliche Äußerungen somit nicht als Stipendiat sondern privat und als Alt-Cusaner veröffentliche. Selbiges gilt auch für meine Äußerungen zur Studienstiftung, auch wenn es meines Wissens nach von dieser Seite aus keine solche Einschränkungen an die Veröffentlichungen Geförderter gibt.
Carlo, wie hältst du’s eigentlich mit der Gretchenfrage?
Seit meinem Abitur wurde ich immer wieder und von den verschiedensten Personen gefragt, wie das geht: Wie kann ich gleichzeitig Physik studieren und dazu noch Geld von der katholischen Kirche erhalten? Schließt sich das nicht aus? Und darüber hinaus: wie verträgt sich das mit der Förderung der (angeblich ideologiefreien) Studienstiftung? Das passt doch alles nicht so ganz zusammen. Mit bald einem Jahr Abstand zum Ende meiner aktiven Förderungszeit blicke ich zurück und stelle mir noch einmal diese Frage. Dieser Blog-Post ist ein Abriss der Förderzeit und eine Antwort an alle, die sich nun selbst oben Genanntes fragen. Aber der Reihe nach.
Mein Abitur und die Bewerbung um Stipendien
Wir befinden uns im Sommer 2016, ich habe nach einem standesgemäßen Mallorca-Urlaub mit meinem Dunstkreis aus der Schule gerade freudig mein Abitur entgegengenommen und plane wie es weiter gehen soll. Während die partyfreudige Hälfte meiner alten Stufe am Dortmunder Phoenixsee, im alten Weinkeller oder der inzwischen der Pandemie zum Opfer gefallenen Diskothek Daddy Blatzheim den “Letzten Sommer in Freiheit” genießt, habe ich noch ein paar Klausuren an der Uni zu schreiben. Physik IV (Quantenmechanik in Theorie und Experiment), numerische Mathematik und Allgemeine Relativitätstheorie stehen noch bis Oktober auf dem Plan. Von außen betrachtet klingt das sicherlich ziemlich dämlich. Wer lernt schon freiwillig Mathe nach den Mühen des höchsten deutschen Schulabschlusses? Nun ja. Ich anscheinend. Wie es dazu kam und vor allem warum, soll das Thema eines anderen Posts sein. Die Kurzfassung lautet jedoch so: In der neunten Klasse habe ich meinen ehemaligen Physiklehrer wegen einer Kleinigkeit und in aller Bescheidenheit korrigiert. Blöd nur, dass es sich um Teilchenphysik und damit um sein Steckenpferd handelte. Kein Jahr später saß ich schon in meiner ersten Physikvorlesung. Entgegen anfänglicher Vorbehalte habe ich dann auch noch die Klausur zum Semesterende mitgeschrieben und nicht so schlecht abgeschnitten, wie von mir selbst erwartet. Es folgten vier Semester Physik, die ich während der elften und zwölften Klasse absolvierte. Damit kommen wir zur Ausgangslage: mit einem Einser-Abitur in der Hand und ein Ass im Ärmel für die geplanten Bewerbungen um Stipendien zur Finanzierung meines weiteren Studiums begebe ich mich auf die Internet-Recherche.
Diese ergab das folgende Bild: In Deutschland gibt es eine ganze Reihe von Stipendien für Studierende. Allen voran stehen die 13 großen Begabtenförderungswerke: Das (muslimische) Avicenna Studienwerk, das (katholische) Cusanuswerk, das (jüdische) Ernst Ludwig Ehrlich Studienwerk, das (evangelische) Studienwerk Villigst, die (SPD-nahe) Friedrich Ebert Stiftung, die (FDP-nahe) Friedrich Naumann Stiftung für die Freiheit, die (Gewerkschafts-nahe) Hans Böckler Stiftung, die (CSU-nahe) Hanns Seidel Stitung, die (Grünen-nahe) Heinrich Böll Stiftung, die (CDU-nahe) Konrad Adenauer Stiftung, die Stiftung der deutschen Wirtschaft sowie die (unabhängige) Studienstiftung des deutschen Volkes. Da ich politischen Stiftungen grundsätzlich kritisch gegenüberstand, nicht besonders Wirtschafts-affin und weder evangelisch, jüdisch noch muslimisch bin oder war, kamen zwei Stipendien in Frage: Das des Cusanuswerk und das der Studienstiftung. Mit der Hilfe meiner nun ehemaligen Schule stellte sich die erste Runde der jeweiligen Bewerbungsverfahren glücklicherweise als machbar heraus. Doch dann wurde es kniffeliger. Das Cusanuswerk lud mich zuerst nach Bonn zum Auswahltermin ein.
Dort warteten im Oktober 2016 drei Gespräche auf mich: Zunächst ein Gespräch über meinen bisherigen Lebenslauf und mein angestrebtes Studium (das war einfach – dazu konnte ich ja schon ein bisschen mehr erzählen als die durchschnittliche Bewerberin oder der durchschnittliche Bewerber), dann eine kleine Diskussion mit einem anderen Bewerber (der lustigerweise letztendlich aufgenommen wurde – wir haben ziemlich gut harmoniert und uns später in Aachen wiedergetroffen) sowie ein Gespräch zu meinem Glauben. Au weia. Darauf hatte ich mich vorbereitet. Ziemlich intensiv sogar. Ich hatte sogar Wochen vorher noch zusammen mit einer befreundeten anderen Bewerberin ein kleines Manifest dazu geschrieben, warum der Katechismus irgendwie doch noch gerade so ganz gut mit naturwissenschaftlichen Erkenntnissen klar kommt. Im Gespräch mit dem Hochschulpastoral, umrahmt von einer Unzahl von Jupps an Metall- und Holzkreuzen sowie einer lebensgroßen Aufnahme von Ratzingers Gesicht an der Wand, zusammen mit ein paar frommen Psalmen auf dem Tisch platzte es nur so aus mir hervor: Nachdem ich zwei Minuten geredet hatte, wollte ich noch einmal neu starten. Ich kotzte mich förmlich aus über die Ungerechtigkeiten in der katholischen Kirche, über den fragwürdigen Einfluss in der Welt, die unzureichende Hilfe der Weltkirche im Bezug auf ertrunkene Geflüchtete im Mittelmeer. Es ging weiter mit meiner Sicht als Naturwissenschaftler auf die Zerwürfnisse in Glaubensfragen und wie ich wohl zu dem Glauben Einsteins stehen würde. Am Ende bescheinigte man mir mit einem Lächeln, “noch auf der Suche zu sein”. “Allerdings”, dachte ich und stimmte zu, in der festen Annahme, dass es dann wohl nichts mit dem Stipendium würde. Doch weit gefehlt. Kurz darauf erhielt ich Post aus Bonn mit allerlei Formularen, die den Beginn meiner Zeit als Cusaner darstellen sollten.
Im Januar 2017 wurde ich daraufhin von der Studienstiftung eingeladen. Ich erschien dort im Gegensatz zu den meisten anderen Bewerber*innen nicht mit Schlips und Kragen sondern in einem äußerst gemütlichen Pullover. Den Vortrag, den ich dort zu halten hatte und der über mein Schicksal als Stipendiat entscheiden sollte, bereitete ich im Zug zu dem Wochenende an der Mosel vor. Letztendlich entschied ich mich (auch in diesem Punkt zugegebenermaßen: gewagterweise) dafür, einen TED-talk zu imitieren. Wer diese nicht kennt, der und dem sein folgendes dazu gesagt: Es handelt sich um kurze, rhetorisch hervorragend vorbereitete Vorträge zu beinahe beliebigen, doch allgemeinverständlichen Themen, die vor Publikum aufgenommen werden und dann auf YouTube landen. Das Thema meines Vortrags war das Spenden an wohltätige Organisationen im Rahmen des sog. “Effektiven Altruismus”. Zur anschließenden Diskussion bastelte ich vier kleine Körbchen und gab jeder teilnehmenden Person einen 10 €-Schein in die Hand. Es sollte gemeinsam entschieden werden, welcher der vier Organisationen (vertreten durch die Körbe) welcher Geldbetrag überweisen werden sollte. Darüber hinaus hatte ich noch zwei weitere Interviews: eines geführt durch einen Biologie-Doktoranden, dem ich schließlich noch seine Fragen zur Röntgen-Beugung in biologischen Medien erklären konnte, und einem ehemaligen Philosophie-Studenten, der seit mindestens 30 Jahren in Unternehmen arbeitete. Letzterer interessierte sich besonders, wie ich einerseits an Metal-Musik, Klassik und Jazz interessiert sein könnte und nannte mich (heute würde man es Cringe nennen) “eine coole Socke”. Meine ich-habe-hier-nichts-zu-verlieren-Einstellung war erfolgreich, wie ich ein paar Tage später abermals am Inhalt meines Briefkastens überprüfen konnte.
Zusammengefasst kann ich also übrigens folgenden Tipp zur Bewerbung bei den beiden Werken geben: Wer wagt, gewinnt. Gerade bei der Studienstiftung würde ich außerdem noch darauf hinweisen, dass Diskussionen à la Impf-Pflicht Ja/Nein, Pränataldiagnostik Ja/Nein, Parteienverbot Ja/Nein alle auf den ewigen Diskurs Freiheit gegen Sicherheit reduziert werden können. Ich würde davon ausgehen, dass daher irgendjemand sicherlich einmal den (sinnvollen) Punkt einbringen wird, dass sich die Diskussionen alle wiederholen und am Ende moralische Entscheidungen ausschlaggebend sind. Ich habe es als oftmals viel interessanter erlebt, dann direkt über diese ethischen Themen zu sprechen. Die Kunst besteht meiner Meinung nach dann darin der Diskussion Raum zu geben, schlussendlich aber zu einem konkreten Resultat zu kommen.
Glaubenswandel im Cusanuswerk
Aufgenommen in beiden Werken musste ich mich entscheiden: Lasse ich mich vom Cusanuswerk oder der Studienstiftung finanziell fördern? Die Entscheidung dafür war recht einfach: Eine finanzielle Förderung durch das Cusanuswerk schließt eine ideelle Förderung durch die Studienstiftung nicht aus, andersrum funktioniert es allerdings nicht. Explizit bedeutet das: Wer jeden Monat Geld vom Cusanuswerk erhält, kann eine Vertrauensdozentin der Studienstiftung in Anspruch nehmen; wer Geld von der Studienstiftung erhält, kann jedoch nicht zur Jahrestagung des Cusanuswerks. Also entschied ich mich für die Kombination, die es mir erlaubte, die Förderung beider Werke zu genießen. Das bedeutete zwar doppelt so viele Semesterberichte, aber auch doppelt so viele Kontakte zu anderen interessanten Menschen. Ungeachtet meiner eher unorthodoxen (Verzeihung dafür) religiösen Einstellungen zu der Zeit, hätte ich jedoch auch fast das Angebot der Studienstiftung ausgeschlagen: Als ich mitbekam, dass Menschen wie ´